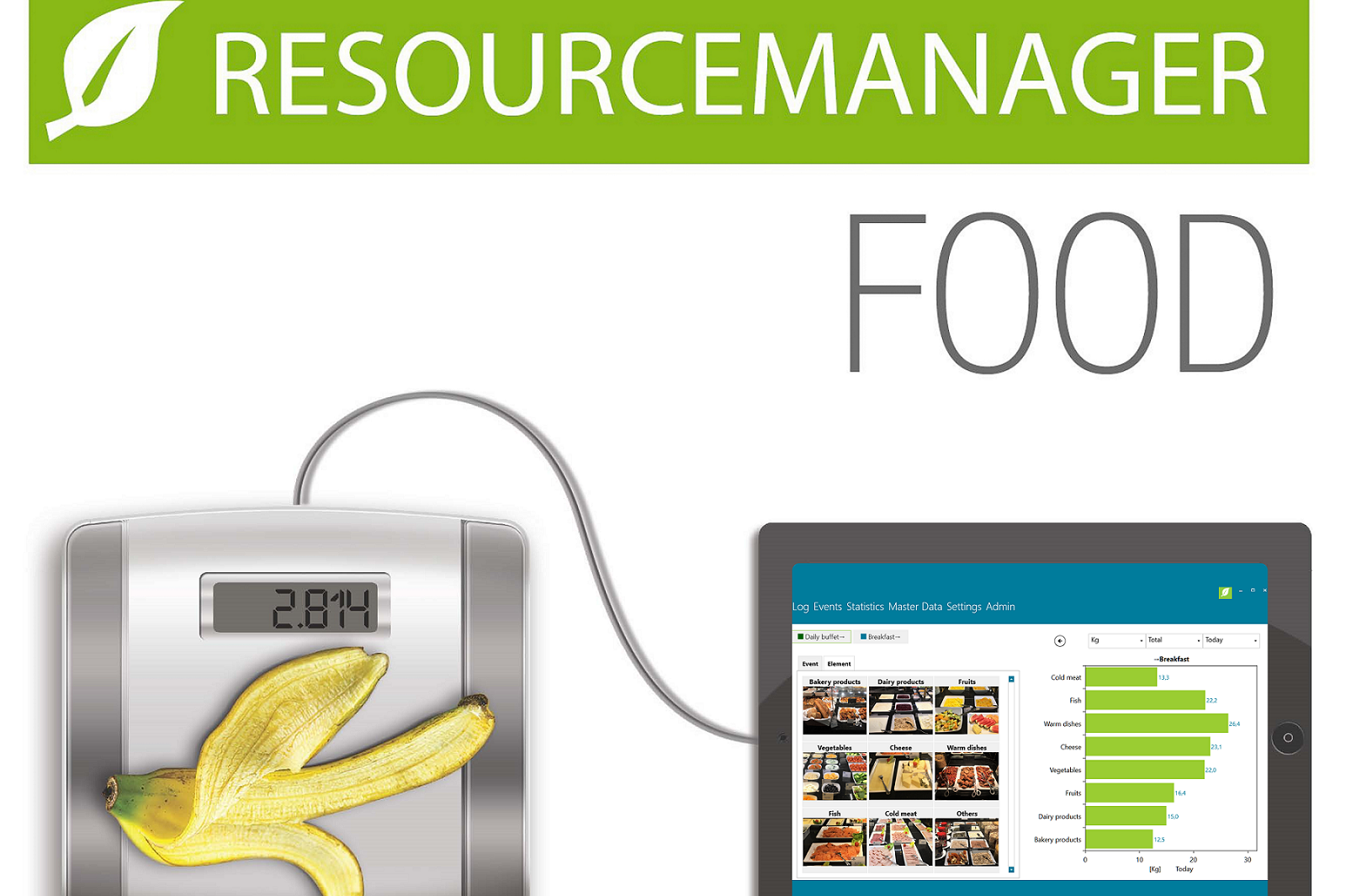Gemeinsam mit fünf Studierendenwerken hat das Münchner Start-up-Unternehmen Delicious Data eine Software entwickelt, um die Nachfrage nach Speisen in der Gemeinschaftsverpflegung zu prognostizieren. Für Küchen, die mit einem Warenwirtschaftssystem arbeiten, ist der Aufwand relativ gering. Denn ein in das System integrierter Algorithmus analysiert die historischen Daten aus einem Zeitraum von mindestens 12 Monaten und kombiniert sie mit aktuellen Faktoren wie dem Wetter, dem Wochentag, Urlaubszeiten oder Brückentagen. "Im Einzelfall können sich diese Faktoren ganz unterschiedlich auswirken", berichtet Valentin Belser, einer der beiden Mitgründer und Geschäftsführer von Delicious Data. So gibt es Standorte, wo das Wetter einen starken Einfluss hat, weil beispielsweise Tischgäste einer Betriebsgastronomie bei schönem Wetter gerne mal zum Mittagessen in einen nahegelegenen Biergarten gehen - sofern vorhanden. Das System kombiniert diese externen Daten und erstellt daraus eine Prognose für den Absatz der kommenden sechs Wochen. Zudem lernt es im Laufe der Zeit automatisch immer mehr dazu. Es vergleicht seine Prognosen mit dem tatsächlichen Verkauf und wird so immer treffgenauer. "Durch den Einsatz des Tools konnten die Speiseabfälle um 15 Prozent verringert werden", berichtet Claus Konrad, Leiter der Hochschulgastronomie beim Studierendenwerk Karlsruhe. "Bei bis zu 9.000 Essen täglich in unserer größten Mensa zahlt sich das System daher nur nicht aus Gründen der Nachhaltigkeit aus, sondern lohnt sich auch wirtschaftlich."
Optional auch Menüplanung
Nach dem gleichen Prinzip wie Delicious Data arbeitet die web-basierte Software von Mitakus. Auch hier sind historische Verkaufs- und Einkaufsdaten sowie Speisepläne aus den Küchen die Grundlage für die Analyse, die mit externen Faktoren wie Wetter, Feier- und Ferientagen kombiniert werden. Vor allem Küchen aus der Betriebsgastronomie nutzen das System, um die produzierten Speisemengen möglichst genau auf den Bedarf hin anzupassen. Wenn es die Küchenleitung wünscht, macht das System auf der Basis vorhandener Daten auch Vorschläge für die Speiseplanung. "Wir gehen damit noch stärker in Richtung Menüplanung", so der Mitakus-Geschäftsführer Roman Wolkow. Dafür können die Küchenverantwortlichen Kriterien definieren wie beispielsweise die Häufigkeit vegetarischer Gerichte und wie lange ein Speiseplan-Zyklus dauert. In Zeiten von Corona wird es durch die zeitweise Schließung von Kantinen sowie die Etablierung von Home Office für die Großküchen noch schwieriger, die Nachfrage nach Mittagessen tagesgenau vorherzusagen und Speiseabfälle zu vermeiden. Digitale Prognose-Instrumente, die komplexe Faktoren besser analysieren können als menschliche Erfahrung, könnten deshalb noch wichtiger werden.