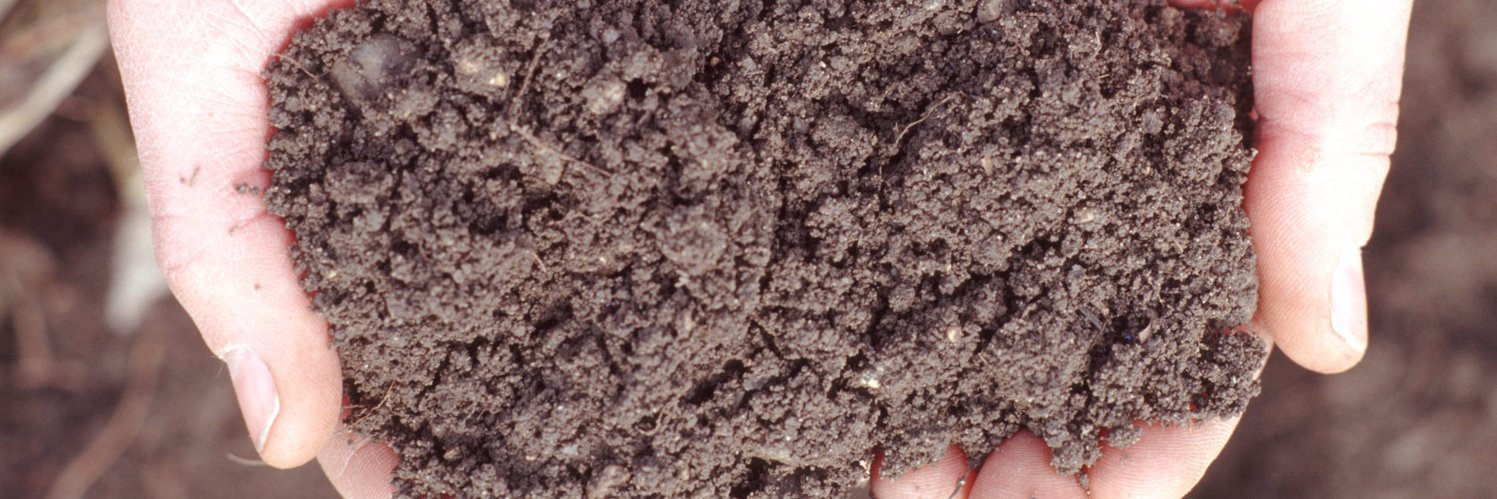Unterrichtsskizze
Die Unterrichtseinheit sollte im Rahmen einer Exkursion auf einen Biobauernhof oder eine ökologisch bewirtschaftete Kleingartenanlage erfolgen. Empfehlenswert wäre, wenn die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit bekämen, die Arbeitsaufträge sowohl auf einem ökologisch als auch auf einem konventionell bewirtschafteten Hof durchzuführen. Im sich daraus ergebenden Vergleich erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass im Ökolandbau in der Regel ein aktiveres Bodenleben und eine breitere Vielfalt an Pflanzen vorzufinden sind.
Einstieg
Zum Einstieg in das Thema Boden lesen die Schülerinnen und Schüler den Sachtext T 1.
Erarbeitung
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Arbeitsaufträge jeweils in Kleingruppen. Jeder Arbeitsauftrag enthält Feld- und Klassenraum-Aufgaben. Die Bearbeitung der Klassenraum-Aufgaben dient der Sicherung und Vertiefung der Beobachtungen.
Bevor mit der Betrachtung der Bodens begonnen wird, sollen sich die Gruppen mit Arbeitsauftrag A 1 "Was wächst denn da?" bewusst machen, welche Bedeutung der Boden für Pflanzen hat. Hierbei sollte herausgearbeitet werden, dass unterschiedliche Pflanzen unterschiedliche Bodenansprüche haben und dass es daher schwer ist, allgemein von einem "guten" oder "schlechten" Boden zu sprechen. Wichtig ist, dass im Vorfeld mit dem Landwirt oder einer anderen Ansprechperson des außerschulischen Lernortes verschiedene geeignete Flächen für diese Aufgabe ausgewählt werden. Untersucht werden könnten:
- Grünland,
- eine Viehweide,
- Ackerrandstreifen an verschieden bepflanzten Feldern,
- steiniger, karger Boden,
- eine Feuchtwiese,
- konventionell bewirtschaftetes Grünland (mit Besitzer absprechen),
- ...
Mit den Arbeitsaufträgen A 2 bis A 5 untersuchen die Kleingruppen die Beschaffenheit und Eigenschaften ihrer Testflächen: Bodeneigenschaften, Bodenlebewesen, Zusammensetzung des Bodens und Zeigerpflanzen werden hier thematisiert.
Sicherung
Zum Abschluss der Einheit können die Schülerinnen und Schüler in einem Expertengespräch der Landwirtin oder dem Landwirt ihre Ergebnisse zu seinen Flächen vorstellen und gemeinsam über mögliche Bodenverbesserung sprechen. In diesem Rahmen kann die Landwirtin oder der Landwirt den Schülerinnen und Schülern die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung erläutern.
Die Unterrichtseinheit "Der Boden" sowie weitere Informationen können Sie hier als Word-Datei und als PDF-Datei kostenlos herunterladen.
Zeitaufwand für die Unterrichtsdurchführung
Für die Exkursion und die Bearbeitung der Feld-Aufgaben sollte ein Tag angesetzt werden. Die Bearbeitung der Klassenraum-Aufgaben erfordert mindestens zwei Doppelstunden (bei 45-Minuten-Takt).
Kompetenzziele
Die Schülerinnen und Schüler ...
- arbeiten miteinander und unterstützen sich gegenseitig.
- führen eigenständig Untersuchungen und Versuche zu einem Thema durch.
- übernehmen Verantwortung für ihre Versuche.
- können Tiere und Pflanzen anhand von Büchern bestimmen.
- stellen Daten und Ergebnisse aus ihren eigenen Beobachtungen dar und präsentieren sie ihren Mitschülerinnen und Mitschülern.
Lehrplanbezug
Die Unterrichtseinheit weist viele Bezüge zu den Bildungsplänen der Sekundarstufe I der Länder auf. Für die Umsetzung bietet sich die Anknüpfung an Themenkomplexe wie "Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen" im Fach Biologie und "Landwirtschaft in Deutschland" im Fach Erdkunde an.
Die Arbeitsmaterialien lassen sich individuell an Lernstand und Arbeitsweise der jeweiligen Schulform und Jahrgangsstufe anpassen.